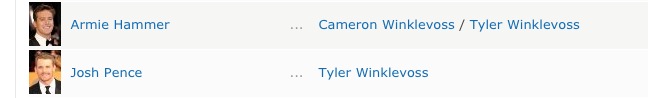von Dominic
„Senden Sie uns bitte ihr Reel, oder aussagekräftige Arbeitsproben zusammen mit der Bewerbung zu“ – so oder so ähnlich lauteten die Aufforderung vieler Firmen, bei denen ich mich in letzter Zeit vorgestellt hatte.
Das Showreel ist in der Branche groß gefragt. Unter einem Showreel versteht man dabei einen kurzen, möglichst spannend und ansprechend zusammengeschnittenen Clip, der dem Kunden zeigt, zu was man fähig ist. Wohingegen im Kamera-, Regie-, oder Ton-Departement weniger wert auf ein Showreel gelegt wird, so sind diese doch besonders im Bereich der visuellen Effekte, im Grafik- und Animationsbereich und im Farbkorrekturbereich sehr gern gesehen, da sie kurz und direkt zeigen, was man schon erstellt und bearbeitet hat. Viele Blogger haben dabei schon Tipps dazu verfasst, wie man sein Können am besten in Form eines Showreels verpackt.
Peter Quinn hat uns dabei mit seinem ganz eigenen Showreel gezeigt, wo die Probleme der Motion Graphics Branche liegen.
Peter Quinn ist seinerseits Art Director und selbsternannter „Motion Graphics Shaman“ bei der kanadischen Firma Blink Media. Er ist weiterhin damit beauftragt die eingesandten Showreels anzusehen, zu bewerten und eventuelle neue Arbeitskräfte zu kontaktieren. Kein Wunder, dass er sehr genau weiß, wie die Branche aktuell tickt und welche Klischees es zu beachten gilt.

Als er Mitte dieses Jahres selbst sein eigenes Showreel begann, fiel ihm nach einem Drittel seiner Arbeit auf, dass er praktisch ein identisches Showreel zu einem seiner Bewerber erstellt hatte.
Und so begann er damit ein ironisches Showreel zu erstellen. Voll mit all den „Don’ts“, und Unarten der aktuellen Motion Graphics-Szene.
Dabei verarscht er charmant all die populären Stile der Animation, die aktuell so gern verwendet werden. Zu viel Plexus, unnötiges 3D-Tracking, drehende Smartphones und was es nicht noch aktuell für Design-Unarten gibt. Ironischerweise ist sein Reel dabei erstaunlich gut gemacht und beeindruckt auf eine charmante Art und Weise, die so anders von all den anderen Arbeitsproben ist.